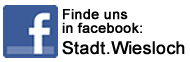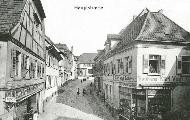Wieslochs Stadtteile
Die Stadt Wiesloch hat neben der Kernstadt noch vier Stadtteile: Altwiesloch, Baiertal, Frauenweiler und Schatthausen.
Altwiesloch
Altwiesloch war im Laufe der Geschichte zeitweise eigenständig, und manchmal gehörte es zu Wiesloch. Im Jahre 1908, nach dem Bau der Großherzöglichen Heil- und Pflegeanstalt, wurde es endgültig nach Wiesloch eingemeindet. Es gibt, anders als in Baiertal und Schatthausen, keinen Ortschaftrat.
Weitere Infos siehe Seite Altwiesloch.
Baiertal
Die ehemals eigenständige Gemeinde Baiertal wurde im Rahmen der Verwaltungsreform zum 31.01.1972 nach Wiesloch eingemeindet, gleichzeitig wurde ein Ortschaftsrat eingerichtet.
Weitere Infos siehe Seite Baiertal.
Frauenweiler
Frauenweiler wurde im Jahre 1937 gegründet, als eine große Wohnungsnot herrschte. Die Siedlungshäuser wurden etwas westlicher gebaut als die mittelalterliche Siedlung Frauenweiler. Es gibt, anders als in Baiertal und Schatthausen, keinen Ortschaftrat.
Weitere Infos siehe Seite Frauenweiler.
Schatthausen
Die ehemals eigenständige Gemeinde Schatthausen wurde im Rahmen der Verwaltungsreform zum 31.01.1972 nach Wiesloch eingemeindet, gleichzeitig wurde ein Ortschaftsrat eingerichtet.
Weitere Infos siehe Seite Schatthausen.